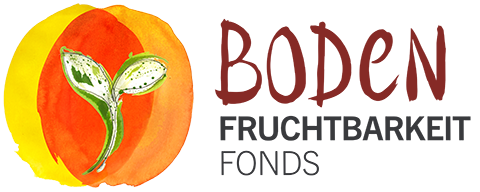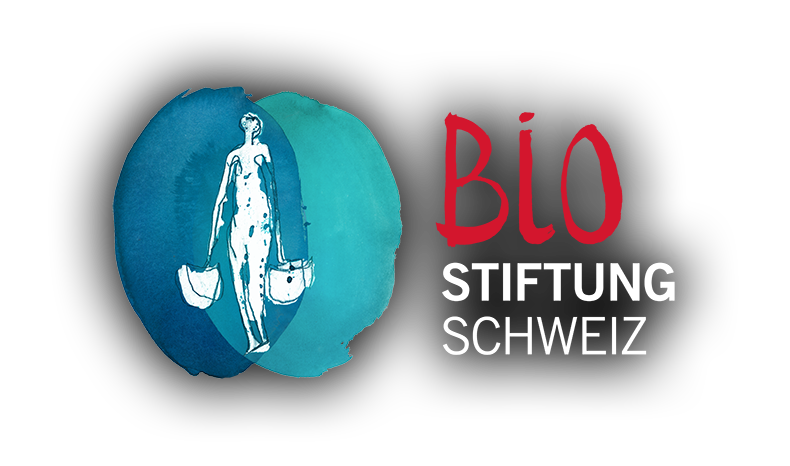Hofportrait Gärtnerei am Goetheanum
Zwischen Blumen, Gemüsepflanzen und dem kraftvollen Bau des Goetheanum liegt eine Gärtnerei, die mehr ist als ein Ort des Anbaus: Sie ist ein lebendiger Gesprächsraum zwischen Mensch und Natur. Rob Bürklin, Gärtner und Mitgestalter, spricht mit Christopher Schümann über Biodiversität, kosmische Rhythmen und die Kunst, einem Ort zuzuhören.
Text Christopher Schümann
Fotos Goetheanum / Xue Li
(Artikel aus dem MAGAZIN 7/24 der Bio-Stiftung Schweiz.)
Die Gärtnerei am Goetheanum liegt in Dornach, einem Ort im Kanton Solothurn, etwa 15 Kilometer von Basel entfernt. Der von ihr gepflegte Gartenpark umgibt das Goetheanum, das von Rudolf Steiner entworfen wurde und das seit 1993 unter Denkmalschutz steht. Dieser Bau ist ein extrem unkonventionelles Pionierprojekt in der Geschichte des frühen Betonbaus. Das Goetheanum steht auf einem Hügel und zieht wegen seiner ungewöhnlichen und kraftvollen plastischen Formen auch fast 100 Jahre nach seiner Fertigstellung noch viele Besucher an. Der Goetheanum Gartenpark ist aus Fussgängerperspektive betrachtet gross und wer ihn näher kennenlernen will, muss reichlich Zeit mitbringen oder immer wieder kommen. Man findet viele Sitzgelegenheiten an ganz unterschiedlichen Orten und wenn man sich dort aufhält und aufmerksam um sich blickt, bemerkt man schnell: hier gibt es viel zu entdecken. Was sofort auffällt ist die Vielfalt an Pflanzen. In der Gärtnerei wachsen allerlei Blumen und Kräuter zwischen den Nutzpflanzen. Calendula, Kornblumen usw. Wer auf nüchterne, militärische Ordnung im Gemüsebeet viel Wert legt, wird es hier wohl nicht mögen und die bunte Vielfalt als chaotisch und unaufgeräumt empfinden. Mir gefällt diese Verspieltheit der verschiedenen Farben und Formen.
Die Gärtnerei am Goetheanum ist seit 2021 Partnerbetrieb des Bodenfruchtbarkeitsfonds der Bio-Stiftung Schweiz. Um den Ort besser kennenzulernen, habe ich mit Rob Bürklin gesprochen. Er ist Gärtner hier am Ort und auf meine Frage, was hier das Kernanliegen ist, sagte er das Folgende: „Die ganze Landschaftsgestaltung ist uns das Hauptanliegen. Wie trete ich mit der Natur als Mensch unmittelbar in Verbindung, ohne, dass ich jetzt primär nur den Anspruch habe auf Ertrag? Das hier ist also nicht primär Anbaufläche und das lässt uns daher mehr Freiheiten.
Wir können uns fragen, wer und was ist mein Gegenüber? Wie kriege ich ein Verhältnis hin? Dieses Verhältnis ist und darf und muss automatisch vom Menschen geprägt sein, wie fast alle Landschaften auf dem Kontinent vom Menschen geprägt sind. Aber jetzt habe ich die Möglichkeit, das speziell zu gestalten. Und jetzt könnten wir das so machen wie in Versailles, das heisst alles an dem Reissbrett entwerfen und dann umsetzen. Wir können aber auch sagen, wir möchten ein Gegenüber haben in der Natur, das auch eine eigene Kraft haben darf. Jetzt muss ich dem Gegenüber Freiheiten zugestehen, so wie wir Menschen das unter uns ja auch machen. Ich muss der Natur eine Sprachmöglichkeit geben. Die Natur kann nur sprechen, wenn sie nicht in ein Korsett eingeklemmt ist. In der Biodiversität, die mir dann begegnet, ist der Natur die Möglichkeit gegeben, mit mir zu kommunizieren. Darin drückt sich dann die Natur mir gegenüber aus. Auf der anderen Seite muss ich mich selbst befähigen, für diese Sprachmöglichkeiten aufzuwachen. Ich muss auch lernen selbst zu reden, indem ich gestalte. So entsteht ein Gespräch. Und dieses Gespräch entwickelt sich bei uns eigentlich immer weiter.“

DIE BIOGRAPHIE DES ORTES
„Man muss sich, um so arbeiten zu können, Möglichkeiten der Wahrnehmung schaffen“, sagt Rob. „Der Färbergarten zum Beispiel, der gerade neu entstanden ist. Da geht es schon Richtung Biographie des ganzen Ortes. Die Bilder, die im Goetheanum mit Pigmenten aus Färberpflanzen gemalt worden sind, die gehören zu diesem Ort. Und jetzt gehören eben auch Pflanzen zu diesem Ort, aus denen man solche Farben herstellen kann. Dieser Impuls darf hier leben, er soll auch im Garten leben können. Wir wollen diesem Impuls lebendig im Garten begegnen können und wir wollen das auch für andere Menschen möglich machen.“
PFLANZEN, BODEN, TIERE UND MENSCHEN IM VERHÄLTNIS ZUM KOSMOS
„Wenn wir den Gedanken der Begegnung noch erweitern, dann wollen wir auch ermöglichen, dass die Pflanzen, Tiere und Menschen ihre Beziehung zum Kosmos vertiefen können. Das ist ganz konkret gemeint. Ein Rüebli muss nach Rüebli schmecken dürfen, eine Rande nach Rande. Wie können wir dabei helfen, dass sich die Rande mit dem geistigen Impuls verbinden kann, der in der Rande liegt? Für uns ist das eine wichtige Frage. Die Antwort liegt für uns darin, dass wir der Pflanze die Möglichkeit bieten müssen, dass sie sich mit ihrer ganzen Umgebung möglichst gut verbinden kann. Da haben wir die Präparate und den hofeigenen Dünger, die dabei helfen sollen, dass das möglich wird. Da wirkt im Grunde das Ganze zusammen, was Rudolf Steiner als Hofindividualität beschreibt. Mit dem Dünger dünge ich ja nicht die Pflanze, sondern den Boden. Und ich dünge den Boden so, dass er sich mit dem Kosmos gut verbinden und so die Entwicklung der Pflanzen möglichst gut unterstützen kann.“
Was heisst das ganz konkret, sich mit dem Kosmos verbinden können? Ich wollte es jetzt mal genauer wissen. Denn meine Beobachtung ist, dass die biodynamische Wirtschaftsweise und das Label Demeter viel Vertrauen geniessen. Und das hat auch Gründe. Selbst Helmut Zander, der vor einigen Jahren als scharfer Kritiker der Anthroposophie Rudolf Steiners auftrat, hat zugegeben, dass Demeter wohl so etwas wie der Mercedes unter den Biolabeln ist, weil die Anforderungen und Qualitätsansprüche dort am höchsten sind. Zum Beispiel dürfen Kühe ihre Hörner hier behalten, weil die Demeter-Richtlinien vorgeben, dass die Kühe genügend Platz haben müssen. Dadurch sind sie ausgeglichener und nicht gefährlich. Das kommt bei vielen Menschen gut an. Aber wenn die bio-dynamischen Präparate ins Spiel kommen, dann denken doch viele Menschen: Das ist Hokuspokus oder Voodoo und da will ich nicht mitgehen. Verständlich ist das. Denn die Idee, Kuhdung in Kuhhörner zu stopfen und diese dann für die Wintermonate unter der Erde zu vergraben, dürfte auch bei vielen Menschen, die ansonsten aufgeschlossen für Neues sind, zunächst einmal Stirnrunzeln hervorrufen. Ich wollte also wissen, ob es möglich ist, solche ungewöhnlichen Massnahmen in wenigen Worten gedanklich nachvollziehbar zu machen. Rob sprach dann erst einmal von der Berührung und der Dankbarkeit. Man berührt als Mensch den Kuhdung, das Kuhhorn und den Boden und bringt sie damit in Verbindung. Und von Dankbarkeit sprach er in dem Sinne, dass man sich als Mensch ja leicht klarmachen kann, dass man ohne den fruchtbaren Boden überhaupt nicht da wäre. Und diese Tatsache kann das Gefühl der Dankbarkeit hervorrufen, was ja über lange Zeiträume hin und in vielen Kulturen auch der Fall war. Aber nun noch konkreter gesprochen: „Der Boden ist ja nicht nur mit der Erde verbunden, sondern er steht auch im Zusammenhang mit der Sonne zum Beispiel, oder mit den Jahreszeiten, und das sind im Grunde kosmische Beziehungen, die nicht statisch sind. Hier spielen bestimmte Rhythmen eine grosse Rolle. Der Boden ist im Winter ganz anderen Kräften ausgesetzt als im Sommer. Das Leben zieht sich im Winter in den Boden zurück. Und damit kann man arbeiten.“
Wenn wir nun die Kuh nehmen, dann ist der Kuhdung einer der wertvollsten Dünger, die überhaupt bekannt sind. Und Rob meinte, dass das auch Wissenschaftler der ETH-Zürich kaum abstreiten würden. Diese hohe Qualität des Kuhdungs hängt nun damit zusammen, dass der Verdauungstrakt der Kühe so hoch entwickelt ist, wie bei kaum einem anderen Tier. Die hohe Qualität beim Dung kann allerdings nur entstehen, wenn die Kühe wesensgemäss ernährt werden, das heisst, wenn sie sich in der warmen Jahreszeit ihr Futter idealerweise auf einer artenreichen Wiese selbst suchen können und wenn sie auch im Winter nur Heu bekommen, also das, was sie auch von sich aus fressen würden. Nun stopft man also diesen hochwertigen Kuhdung ins Horn und vergräbt ihn im Boden. Mit dem Kuhdung vergräbt man das, was die Kuh aus den herbstlichen Gräsern, Kräutern und Blumen gemacht hat. Man vergräbt also gewissermassen den Substanz gewordenen Herbst und lässt ihn im Boden überwintern. Unter normalen Bedingungen, das heisst in der freien Natur, wäre von dem Kuhfladen nach etwa einem Monat nichts mehr aufzufinden. Man schützt also den Kuhdung auf diese Weise auch vor dem vollständigen Verzehr durch Fliegen, Würmer und anderes Getier. Im Frühling holt man ihn dann aus dem Boden und muss sich noch etwa einen Monat lang um ihn kümmern, bis er den richtigen Zustand erreicht hat. Dann löst man den nun stark verwandelten und in Kompost übergegangenen Kuhdung in sehr viel Wasser auf, rührt die wässrige Substanz etwa eine Stunde auf eine bestimmte Art und Weise und bringt die wässrige Substanz mit Spritzen auf dem ganzen Gelände aus. Diese Substanz, die man da ausbringt, so Rob, ist das, was die Kuh geben kann, aber in sehr stark veredelter Form.
Interessant fand ich, dass ja auf diese Weise etwas von der Kuh an Orte gelangt, an die sie niemals gehen würde und auch nicht gehen dürfte, zum Beispiel in den Gemüsegarten. Viele Fragen blieben offen. Aber das eine oder andere wurde verständlicher.

DIE MENSCHEN UND QUALITÄTEN DER ZUSAMMENARBEIT
Aber zurück zu der Wahrnehmung der Natur und dem Gespräch mit ihr. Wie arbeiten die Menschen hier zusammen, um diese Art von Landschaftsgestaltung hinzubekommen.
Rob Bürklin sagte dazu, dass es hier nicht den klassischen Top-Down-Ansatz gibt, sondern man arbeitet mit möglichst flachen Hierarchien. Das hatte uns auch schon Benno Otter erzählt (siehe Beitrag in diesem Heft). Das bedeutet, dass die Mitarbeiter jeweils die Verantwortung übernehmen für bestimmte Orte. Man kann sich natürlich austauschen und miteinander reden über bestimmte Gestaltungsfragen. Aber die Mitarbeiter sollen ja lernen, auf ihre eigene Weise mit der Natur ins Gespräch und damit in die Gestaltung zu kommen. Wenn es um grössere übergreifende Gestaltungsfragen geht, dann sind natürlich mehr Menschen in die Entscheidungsprozesse einbezogen.
In den Wintermonaten, wenn es draussen weniger zu tun gibt, treffen sich die Mitarbeiter öfter, um ihr Wissen miteinander zu vertiefen. Fest angestellte Gärtner gibt es zwölf. Dazu kommen zwei Lehrlinge und einige freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Umgebung sowie einige Menschen, die im Rahmen eines geschützten Arbeitsplatzes über die Tagesstätte Andrena mitarbeiten.
DER BODEN UND DIE FRÜCHTE
Der Boden der Gärtnerei am Goetheanum ist ein schwerer Lehmboden. Er ist in einem guten krümeligen Zustand, aber man kann ihn nach Niederschlägen lange nicht begehen, da es sonst schnell zu Verdichtungen kommt. Wo Verdichtungen sind, wachsen gern Wurzelunkräuter, die den Boden wieder auflockern wollen, die aber natürlich nicht so gern von den Gärtnern gesehen sind. Seit der Betrieb Mitglied im Bodenfruchtbarkeitsfonds ist, kommt der Bodenexperte Ulrich Hampl zweimal pro Jahr zu Besuch. Dadurch konnte das Problem der Verdichtungen besser angegangen werden. Wie auf sehr vielen Betrieben bereits erfolgreich umgesetzt, soll auch hier eine mechanische Tiefenlockerung mit der gleichzeitigen Einsaat von Gründüngungsgemengen das Problem ein Stück weit lösen. Durch die mechanische Lockerung werden hierbei die Verdichtungen aufgebrochen und durch die Gründüngung wird dann dafür gesorgt, dass die Wurzeln bis in tiefere Schichten vordringen können. Und den Wurzeln folgt dann auch das Bodenleben in die Tiefe, sodass der Lebensraum sich nach unten hin erweitern kann. Der Boden wird nun also im Herbst und durch den Winter regelmässig mit Gründüngung aufgelockert und belebt. Zur Zeit steht noch keine Maschine zur Verfügung, die den Boden bis in tiefere Schichten auflockern könnte. Daran wird aber gearbeitet. Für die Nährstoffe sorgt neben der Gründüngung ein Kompost aus Kuhdung, pflanzlichen Reststoffen und Küchenabfällen. Ansonsten wird keine organische Düngung aus Hornspänen oder Ähnlichem verwendet, sondern bei stark zehrenden Kulturen wie Kohl häufiger auch Mulch. Das führt im Gemüse nicht zu Maximalerträgen, aber zu gesunden und intensiv schmeckenden Früchten. Diese werden wöchentlich an einem Stand am Goetheanum direkt vermarktet. Bei der Gelegenheit werden auch selbst hergestellte Kräuterteemischungen und noch andere Produkte von benachbarten Demeter-Höfen mit vermarktet, zum Beispiel Apfelmost.
Die Gärtnerei am Goetheanum verzichtet auf Hybridsaatgut. Man möchte den Pflanzen damit Geschmack, Individualität und Ausdrucksmöglichkeit statt einem uniformem Korsett aus konventioneller Züchtung geben, wo alle Pflanzen dann genetisch gleich wären. Für diese Entscheidung zugunsten von frei abblühenden Sorten gibt es noch andere, unter anderem gesundheitliche Gründe, deren ausführliche Darstellung aber den Rahmen hier sprengen würde.
UND DIE ZUKUNFT?
In der näheren Umgebung wird gebaut, und es wird hier bald noch dichter besiedelt sein und nebenan hat der Hof gerade auf Bio umgestellt. «Das ist doch toll», findet Rob. Das sind Veränderungen, die auch Möglichkeiten mit sich bringen. In Zukunft wäre es schöner, wenn es noch mehr Austausch und Durchdringung geben
könnte.
Der Vogel beachtet ja auch keine Grundstücksgrenzen, sondern lebt sich im gesamten Habitat aus. Solche Dinge können hier sein. Es ist ja ein allzeit geöffneter Garten. Manchmal kommt es zu unschönen Situationen zwischen Hunden, die Gassi geführt werden, und den Schafen und Kühen. Aber das gehört wohl dazu. Bereits jetzt besteht viel Austausch und Zusammenarbeit mit dem befreundeten Hof Untere Tüfleten, was sich in Zukunft gern noch weiter entwickeln darf. Aber
auch der Austausch mit den Parkbesuchern oder den Kunden in den Privatgärten, die von der Gärtnerei gepflegt werden, entwickelt sich schön und auch hier
gibt es noch weiteres Entwicklungspotenzial. Schön wäre, wenn mit den Bauern nebenan auch in ökologischer Hinsicht sich ein Austausch entwickeln würde,
vielleicht kann es klein anfangen. Vielleicht wird mehr daraus. Wer weiss das schon?
Wir wünschen der Gärtnerei am Goetheanum und ihren Mitarbeitern jedenfalls noch viele gelungene Entwicklungsschritte, wo auch immer es hingehen will.
Betriebsspiegel
12 feste Mitarbeiter und ca. 12 begleitete Mitarbeitende über die Tagesstätte Andrena sowie einige ehrenamtliche Helfer
2 Lehrlinge
3 Mutterkühe mit Kälbern (Rhätisches Grauvieh)
5 Engadiner Schafe
Gemüsebau
Hochstamm-Obstwiesen
Rosen- und Blumenbeete
Kräuter- und Färbergarten
Herstellung und Versand von
biodynamischen Präparaten
Floristik
Privatgartenabteilung
Wir freuen uns, wenn Sie diesen Beitrag mit Ihrem Netzwerk teilen!

Hofportrait Gärtnerei am Goetheanum
Zwischen Blumen, Gemüsepflanzen und dem kraftvollen Bau des Goetheanum liegt eine Gärtnerei, die mehr ist als ein Ort des Anbaus: Sie ist ein lebendiger Gesprächsraum zwischen Mensch und Natur. Rob Bürklin, Gärtner und Mitgestalter, spricht mit Christopher Schümann über Biodiversität, kosmische Rhythmen und die Kunst, einem Ort zuzuhören.
Text Christopher Schümann
Fotos Goetheanum / Xue Li
(Artikel aus dem MAGAZIN 7/24 der Bio-Stiftung Schweiz.)
Die Gärtnerei am Goetheanum liegt in Dornach, einem Ort im Kanton Solothurn, etwa 15 Kilometer von Basel entfernt. Der von ihr gepflegte Gartenpark umgibt das Goetheanum, das von Rudolf Steiner entworfen wurde und das seit 1993 unter Denkmalschutz steht. Dieser Bau ist ein extrem unkonventionelles Pionierprojekt in der Geschichte des frühen Betonbaus. Das Goetheanum steht auf einem Hügel und zieht wegen seiner ungewöhnlichen und kraftvollen plastischen Formen auch fast 100 Jahre nach seiner Fertigstellung noch viele Besucher an. Der Goetheanum Gartenpark ist aus Fussgängerperspektive betrachtet gross und wer ihn näher kennenlernen will, muss reichlich Zeit mitbringen oder immer wieder kommen. Man findet viele Sitzgelegenheiten an ganz unterschiedlichen Orten und wenn man sich dort aufhält und aufmerksam um sich blickt, bemerkt man schnell: hier gibt es viel zu entdecken. Was sofort auffällt ist die Vielfalt an Pflanzen. In der Gärtnerei wachsen allerlei Blumen und Kräuter zwischen den Nutzpflanzen. Calendula, Kornblumen usw. Wer auf nüchterne, militärische Ordnung im Gemüsebeet viel Wert legt, wird es hier wohl nicht mögen und die bunte Vielfalt als chaotisch und unaufgeräumt empfinden. Mir gefällt diese Verspieltheit der verschiedenen Farben und Formen.
Die Gärtnerei am Goetheanum ist seit 2021 Partnerbetrieb des Bodenfruchtbarkeitsfonds der Bio-Stiftung Schweiz. Um den Ort besser kennenzulernen, habe ich mit Rob Bürklin gesprochen. Er ist Gärtner hier am Ort und auf meine Frage, was hier das Kernanliegen ist, sagte er das Folgende: „Die ganze Landschaftsgestaltung ist uns das Hauptanliegen. Wie trete ich mit der Natur als Mensch unmittelbar in Verbindung, ohne, dass ich jetzt primär nur den Anspruch habe auf Ertrag? Das hier ist also nicht primär Anbaufläche und das lässt uns daher mehr Freiheiten.
Wir können uns fragen, wer und was ist mein Gegenüber? Wie kriege ich ein Verhältnis hin? Dieses Verhältnis ist und darf und muss automatisch vom Menschen geprägt sein, wie fast alle Landschaften auf dem Kontinent vom Menschen geprägt sind. Aber jetzt habe ich die Möglichkeit, das speziell zu gestalten. Und jetzt könnten wir das so machen wie in Versailles, das heisst alles an dem Reissbrett entwerfen und dann umsetzen. Wir können aber auch sagen, wir möchten ein Gegenüber haben in der Natur, das auch eine eigene Kraft haben darf. Jetzt muss ich dem Gegenüber Freiheiten zugestehen, so wie wir Menschen das unter uns ja auch machen. Ich muss der Natur eine Sprachmöglichkeit geben. Die Natur kann nur sprechen, wenn sie nicht in ein Korsett eingeklemmt ist. In der Biodiversität, die mir dann begegnet, ist der Natur die Möglichkeit gegeben, mit mir zu kommunizieren. Darin drückt sich dann die Natur mir gegenüber aus. Auf der anderen Seite muss ich mich selbst befähigen, für diese Sprachmöglichkeiten aufzuwachen. Ich muss auch lernen selbst zu reden, indem ich gestalte. So entsteht ein Gespräch. Und dieses Gespräch entwickelt sich bei uns eigentlich immer weiter.“

DIE BIOGRAPHIE DES ORTES
„Man muss sich, um so arbeiten zu können, Möglichkeiten der Wahrnehmung schaffen“, sagt Rob. „Der Färbergarten zum Beispiel, der gerade neu entstanden ist. Da geht es schon Richtung Biographie des ganzen Ortes. Die Bilder, die im Goetheanum mit Pigmenten aus Färberpflanzen gemalt worden sind, die gehören zu diesem Ort. Und jetzt gehören eben auch Pflanzen zu diesem Ort, aus denen man solche Farben herstellen kann. Dieser Impuls darf hier leben, er soll auch im Garten leben können. Wir wollen diesem Impuls lebendig im Garten begegnen können und wir wollen das auch für andere Menschen möglich machen.“
PFLANZEN, BODEN, TIERE UND MENSCHEN IM VERHÄLTNIS ZUM KOSMOS
„Wenn wir den Gedanken der Begegnung noch erweitern, dann wollen wir auch ermöglichen, dass die Pflanzen, Tiere und Menschen ihre Beziehung zum Kosmos vertiefen können. Das ist ganz konkret gemeint. Ein Rüebli muss nach Rüebli schmecken dürfen, eine Rande nach Rande. Wie können wir dabei helfen, dass sich die Rande mit dem geistigen Impuls verbinden kann, der in der Rande liegt? Für uns ist das eine wichtige Frage. Die Antwort liegt für uns darin, dass wir der Pflanze die Möglichkeit bieten müssen, dass sie sich mit ihrer ganzen Umgebung möglichst gut verbinden kann. Da haben wir die Präparate und den hofeigenen Dünger, die dabei helfen sollen, dass das möglich wird. Da wirkt im Grunde das Ganze zusammen, was Rudolf Steiner als Hofindividualität beschreibt. Mit dem Dünger dünge ich ja nicht die Pflanze, sondern den Boden. Und ich dünge den Boden so, dass er sich mit dem Kosmos gut verbinden und so die Entwicklung der Pflanzen möglichst gut unterstützen kann.“
Was heisst das ganz konkret, sich mit dem Kosmos verbinden können? Ich wollte es jetzt mal genauer wissen. Denn meine Beobachtung ist, dass die biodynamische Wirtschaftsweise und das Label Demeter viel Vertrauen geniessen. Und das hat auch Gründe. Selbst Helmut Zander, der vor einigen Jahren als scharfer Kritiker der Anthroposophie Rudolf Steiners auftrat, hat zugegeben, dass Demeter wohl so etwas wie der Mercedes unter den Biolabeln ist, weil die Anforderungen und Qualitätsansprüche dort am höchsten sind. Zum Beispiel dürfen Kühe ihre Hörner hier behalten, weil die Demeter-Richtlinien vorgeben, dass die Kühe genügend Platz haben müssen. Dadurch sind sie ausgeglichener und nicht gefährlich. Das kommt bei vielen Menschen gut an. Aber wenn die bio-dynamischen Präparate ins Spiel kommen, dann denken doch viele Menschen: Das ist Hokuspokus oder Voodoo und da will ich nicht mitgehen. Verständlich ist das. Denn die Idee, Kuhdung in Kuhhörner zu stopfen und diese dann für die Wintermonate unter der Erde zu vergraben, dürfte auch bei vielen Menschen, die ansonsten aufgeschlossen für Neues sind, zunächst einmal Stirnrunzeln hervorrufen. Ich wollte also wissen, ob es möglich ist, solche ungewöhnlichen Massnahmen in wenigen Worten gedanklich nachvollziehbar zu machen. Rob sprach dann erst einmal von der Berührung und der Dankbarkeit. Man berührt als Mensch den Kuhdung, das Kuhhorn und den Boden und bringt sie damit in Verbindung. Und von Dankbarkeit sprach er in dem Sinne, dass man sich als Mensch ja leicht klarmachen kann, dass man ohne den fruchtbaren Boden überhaupt nicht da wäre. Und diese Tatsache kann das Gefühl der Dankbarkeit hervorrufen, was ja über lange Zeiträume hin und in vielen Kulturen auch der Fall war. Aber nun noch konkreter gesprochen: „Der Boden ist ja nicht nur mit der Erde verbunden, sondern er steht auch im Zusammenhang mit der Sonne zum Beispiel, oder mit den Jahreszeiten, und das sind im Grunde kosmische Beziehungen, die nicht statisch sind. Hier spielen bestimmte Rhythmen eine grosse Rolle. Der Boden ist im Winter ganz anderen Kräften ausgesetzt als im Sommer. Das Leben zieht sich im Winter in den Boden zurück. Und damit kann man arbeiten.“
Wenn wir nun die Kuh nehmen, dann ist der Kuhdung einer der wertvollsten Dünger, die überhaupt bekannt sind. Und Rob meinte, dass das auch Wissenschaftler der ETH-Zürich kaum abstreiten würden. Diese hohe Qualität des Kuhdungs hängt nun damit zusammen, dass der Verdauungstrakt der Kühe so hoch entwickelt ist, wie bei kaum einem anderen Tier. Die hohe Qualität beim Dung kann allerdings nur entstehen, wenn die Kühe wesensgemäss ernährt werden, das heisst, wenn sie sich in der warmen Jahreszeit ihr Futter idealerweise auf einer artenreichen Wiese selbst suchen können und wenn sie auch im Winter nur Heu bekommen, also das, was sie auch von sich aus fressen würden. Nun stopft man also diesen hochwertigen Kuhdung ins Horn und vergräbt ihn im Boden. Mit dem Kuhdung vergräbt man das, was die Kuh aus den herbstlichen Gräsern, Kräutern und Blumen gemacht hat. Man vergräbt also gewissermassen den Substanz gewordenen Herbst und lässt ihn im Boden überwintern. Unter normalen Bedingungen, das heisst in der freien Natur, wäre von dem Kuhfladen nach etwa einem Monat nichts mehr aufzufinden. Man schützt also den Kuhdung auf diese Weise auch vor dem vollständigen Verzehr durch Fliegen, Würmer und anderes Getier. Im Frühling holt man ihn dann aus dem Boden und muss sich noch etwa einen Monat lang um ihn kümmern, bis er den richtigen Zustand erreicht hat. Dann löst man den nun stark verwandelten und in Kompost übergegangenen Kuhdung in sehr viel Wasser auf, rührt die wässrige Substanz etwa eine Stunde auf eine bestimmte Art und Weise und bringt die wässrige Substanz mit Spritzen auf dem ganzen Gelände aus. Diese Substanz, die man da ausbringt, so Rob, ist das, was die Kuh geben kann, aber in sehr stark veredelter Form.
Interessant fand ich, dass ja auf diese Weise etwas von der Kuh an Orte gelangt, an die sie niemals gehen würde und auch nicht gehen dürfte, zum Beispiel in den Gemüsegarten. Viele Fragen blieben offen. Aber das eine oder andere wurde verständlicher.

DIE MENSCHEN UND QUALITÄTEN DER ZUSAMMENARBEIT
Aber zurück zu der Wahrnehmung der Natur und dem Gespräch mit ihr. Wie arbeiten die Menschen hier zusammen, um diese Art von Landschaftsgestaltung hinzubekommen.
Rob Bürklin sagte dazu, dass es hier nicht den klassischen Top-Down-Ansatz gibt, sondern man arbeitet mit möglichst flachen Hierarchien. Das hatte uns auch schon Benno Otter erzählt (siehe Beitrag in diesem Heft). Das bedeutet, dass die Mitarbeiter jeweils die Verantwortung übernehmen für bestimmte Orte. Man kann sich natürlich austauschen und miteinander reden über bestimmte Gestaltungsfragen. Aber die Mitarbeiter sollen ja lernen, auf ihre eigene Weise mit der Natur ins Gespräch und damit in die Gestaltung zu kommen. Wenn es um grössere übergreifende Gestaltungsfragen geht, dann sind natürlich mehr Menschen in die Entscheidungsprozesse einbezogen.
In den Wintermonaten, wenn es draussen weniger zu tun gibt, treffen sich die Mitarbeiter öfter, um ihr Wissen miteinander zu vertiefen. Fest angestellte Gärtner gibt es zwölf. Dazu kommen zwei Lehrlinge und einige freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Umgebung sowie einige Menschen, die im Rahmen eines geschützten Arbeitsplatzes über die Tagesstätte Andrena mitarbeiten.
DER BODEN UND DIE FRÜCHTE
Der Boden der Gärtnerei am Goetheanum ist ein schwerer Lehmboden. Er ist in einem guten krümeligen Zustand, aber man kann ihn nach Niederschlägen lange nicht begehen, da es sonst schnell zu Verdichtungen kommt. Wo Verdichtungen sind, wachsen gern Wurzelunkräuter, die den Boden wieder auflockern wollen, die aber natürlich nicht so gern von den Gärtnern gesehen sind. Seit der Betrieb Mitglied im Bodenfruchtbarkeitsfonds ist, kommt der Bodenexperte Ulrich Hampl zweimal pro Jahr zu Besuch. Dadurch konnte das Problem der Verdichtungen besser angegangen werden. Wie auf sehr vielen Betrieben bereits erfolgreich umgesetzt, soll auch hier eine mechanische Tiefenlockerung mit der gleichzeitigen Einsaat von Gründüngungsgemengen das Problem ein Stück weit lösen. Durch die mechanische Lockerung werden hierbei die Verdichtungen aufgebrochen und durch die Gründüngung wird dann dafür gesorgt, dass die Wurzeln bis in tiefere Schichten vordringen können. Und den Wurzeln folgt dann auch das Bodenleben in die Tiefe, sodass der Lebensraum sich nach unten hin erweitern kann. Der Boden wird nun also im Herbst und durch den Winter regelmässig mit Gründüngung aufgelockert und belebt. Zur Zeit steht noch keine Maschine zur Verfügung, die den Boden bis in tiefere Schichten auflockern könnte. Daran wird aber gearbeitet. Für die Nährstoffe sorgt neben der Gründüngung ein Kompost aus Kuhdung, pflanzlichen Reststoffen und Küchenabfällen. Ansonsten wird keine organische Düngung aus Hornspänen oder Ähnlichem verwendet, sondern bei stark zehrenden Kulturen wie Kohl häufiger auch Mulch. Das führt im Gemüse nicht zu Maximalerträgen, aber zu gesunden und intensiv schmeckenden Früchten. Diese werden wöchentlich an einem Stand am Goetheanum direkt vermarktet. Bei der Gelegenheit werden auch selbst hergestellte Kräuterteemischungen und noch andere Produkte von benachbarten Demeter-Höfen mit vermarktet, zum Beispiel Apfelmost.
Die Gärtnerei am Goetheanum verzichtet auf Hybridsaatgut. Man möchte den Pflanzen damit Geschmack, Individualität und Ausdrucksmöglichkeit statt einem uniformem Korsett aus konventioneller Züchtung geben, wo alle Pflanzen dann genetisch gleich wären. Für diese Entscheidung zugunsten von frei abblühenden Sorten gibt es noch andere, unter anderem gesundheitliche Gründe, deren ausführliche Darstellung aber den Rahmen hier sprengen würde.
UND DIE ZUKUNFT?
In der näheren Umgebung wird gebaut, und es wird hier bald noch dichter besiedelt sein und nebenan hat der Hof gerade auf Bio umgestellt. «Das ist doch toll», findet Rob. Das sind Veränderungen, die auch Möglichkeiten mit sich bringen. In Zukunft wäre es schöner, wenn es noch mehr Austausch und Durchdringung geben
könnte.
Der Vogel beachtet ja auch keine Grundstücksgrenzen, sondern lebt sich im gesamten Habitat aus. Solche Dinge können hier sein. Es ist ja ein allzeit geöffneter Garten. Manchmal kommt es zu unschönen Situationen zwischen Hunden, die Gassi geführt werden, und den Schafen und Kühen. Aber das gehört wohl dazu. Bereits jetzt besteht viel Austausch und Zusammenarbeit mit dem befreundeten Hof Untere Tüfleten, was sich in Zukunft gern noch weiter entwickeln darf. Aber
auch der Austausch mit den Parkbesuchern oder den Kunden in den Privatgärten, die von der Gärtnerei gepflegt werden, entwickelt sich schön und auch hier
gibt es noch weiteres Entwicklungspotenzial. Schön wäre, wenn mit den Bauern nebenan auch in ökologischer Hinsicht sich ein Austausch entwickeln würde,
vielleicht kann es klein anfangen. Vielleicht wird mehr daraus. Wer weiss das schon?
Wir wünschen der Gärtnerei am Goetheanum und ihren Mitarbeitern jedenfalls noch viele gelungene Entwicklungsschritte, wo auch immer es hingehen will.
Betriebsspiegel
12 feste Mitarbeiter und ca. 12 begleitete Mitarbeitende über die Tagesstätte Andrena sowie einige ehrenamtliche Helfer
2 Lehrlinge
3 Mutterkühe mit Kälbern (Rhätisches Grauvieh)
5 Engadiner Schafe
Gemüsebau
Hochstamm-Obstwiesen
Rosen- und Blumenbeete
Kräuter- und Färbergarten
Herstellung und Versand von
biodynamischen Präparaten
Floristik
Privatgartenabteilung