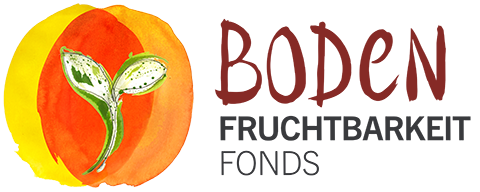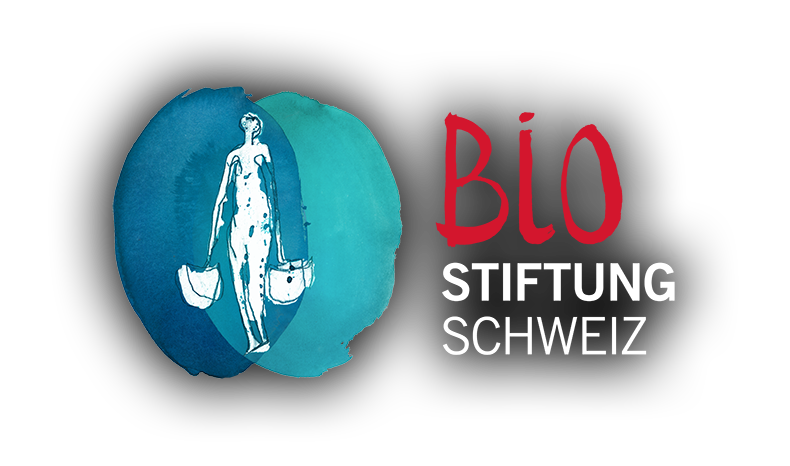Hofportrait Weingut Lenz
Text Christopher Schümann
Fotos Lenz
Auf das Weingut Lenz sind wir vor einigen Jahren aufmerksam geworden, als wir mit der Herausgabe unseres Buches «Das Gift und wir» beschäftigt waren. Wir suchten für den dritten Teil nach Best-Practice-Beispielen, das heisst nach Betrieben, die zeigen, dass es auch ohne synthetische Pestizide geht und vor allem wie. Inzwischen ist das Weingut Lenz Partnerbetrieb im Bodenfruchtbarkeitsfonds geworden, worüber wir uns sehr freuen. Das Weingut von Karin und Roland Lenz liegt in Iselisberg bei Frauenfeld. Es ist das grösste biologisch–dynamische Weingut der Deutschschweiz. (Dieser Artikel ist erstmals im MAGAZIN 2/22 vom Juni 2022 erschienen.)
Auf zweiundzwanzig Hektar wachsen dort Reben an günstigen Südlagen mit sandig–lehmigen Böden. Die Parzellen sind mit weit über dreissig verschiedenen Rebsorten bestockt, fast alles pilzresistente Sorten. Dazu kommen viereinhalb Hektar Biodiversitätsflächen, die zwischen den Parzellen verteilt sind. Roland ist auf einem Weingut aufgewachsen, konnte also schon viel in seiner Kindheit und Jugend lernen, während Karin erst durch Roland dem Weinbau näherkam. Beiden ist wichtig, dass sich auf ihren Flächen langfristig stabile, klimaresistente, fruchtbare und artenreiche Weingärten entwickeln können. Und natürlich ist ihnen das Endergebnis wichtig: hervorragender Wein.
Das Jahr 2021 war für das Weingut Lenz, wie für viele andere Weingüter, wetterbedingt katastrophal. Für Roland Lenz ein klares Zeichen dafür, dass «die schnellste Klimaveränderung, die unser Planet je erlebt hat», in vollem Gange ist. Nach einem schneereichen Winter wurde es schnell warm und trocken. Von Januar bis Mai fiel wenig Niederschlag in Iselisberg. Die zweite Hälfte vom März war viel zu warm und der Frühjahrsfrost Mitte April liess nicht auf sich warten: Frühsorten wie Muscaris, Zweigelt oder auch Pinot Noir wurden in erhöhten Lagen stark geschädigt. Der viel zu kühle Mai verhinderte dann eine normale Vegetationsentwicklung. Erst als Anfang Juni die Temperaturen Fahrt aufnahmen, erholten sich wärmeliebende Kulturpflanzen wie die Weinrebe. Und mit der Wärme kam der Regen … «Nach vier Monaten mit spärlichem Niederschlag fiel über sechs Wochen lang starker Niederschlag, bei oft tropischen Verhältnissen. Herrliches Schnecken- und Pilzwetter! Zudem wurden die fast täglichen Gewitterregen von heftigen Sturmböen und vernichtendem Hagelschlag begleitet, was zu massiven Schäden führte.» Aufgrund dieser Erfahrungen haben Karin und Roland Lenz die Entscheidung getroffen, ab Jahrgang 2021 nur noch Weine aus PIWIs (pilzwiderstandsfähige Sorten) anzubieten, das heisst: der Anteil an PIWIs wird kurzfristig von 80% auf 100% erhöht – ein radikaler und konsequenter Schritt. «Damit werden wir das erste grössere Weingut in Europa, ja wahrscheinlich weltweit sein, das nur noch Weine aus PIWI–Traubensorten anbietet! Welche Gründe liegen dahinter? Und: was sind eigentlich PIWIs?

Karin und Roland Lenz
DIE NEUEN PILZRESISTENTEN SORTEN
Um das Potenzial dieser neuen Züchtungen für den Weinbau der Zukunft richtig einschätzen zu können, lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit: Anfang des 19. Jahrhunderts wurden erstmals amerikanische Rebsorten nach Frankreich importiert. Sie brachten den falschen und echten Mehltau sowie die Reblaus mit nach Europa und die Pilzkrankheiten und Schädlinge hatten aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen Gelegenheit, sich schnell auszubreiten. Die europäischen Sorten waren nicht resistent dagegen, was teilweise zu verheerenden Ertragsausfällen führte. Aber die Menschen liessen sich etwas einfallen. Es entstanden schnell Rebschulen, in denen resistente amerikanische Sorten mit europäischen gekreuzt wurden.
Anfangs weckten die neuen Sorten noch keine Begeisterung, sie wurden aber mit der Zeit immer besser und auch immer erfolgreicher. Der Sortenkatalog des privaten Rebzüchters Seibel führte zum Beispiel 1085 robuste Rebsorten! Ausserdem existierten zwischen den Jahren 1877 und 1968 diverse unabhängige Zeitschriften, die sich mit der Neuzüchtung resistenter Sorten befassten. Dies zeigt, wie aktuell das Thema schon einmal war, auch wenn das heute kaum noch jemand weiss. Aufgrund der beeindruckenden Züchtungsleistungen und der unabhängigen Berichterstattung darüber wurden in Frankreich im Jahr 1958 auf 402 000 Hektar PIWIs angebaut, was 30% der gesamten französischen Rebfläche entsprach. Von einer notdürftig am Leben gehaltenen Randerscheinung kann also keine Rede sein, wenn man auf diese Zeit zurückblickt. An renommierten Weinverkostungen wurden Weine aus den pilzresistenten Reben plötzlich besser bewertet als aus den traditionellen Traubensorten. Das gefiel den Burgunder- und Bordeauxwinzern nicht. Und ab 1955 begann der französische Staat damit, dieser Entwicklung entgegenzuwirken und die Freiheit der Winzer durch Dekrete und Klassifizierungen gezielt einzuschränken. Plötzlich waren durch die Klassifizierungen nur noch 20 PIWIs zugelassen und ab 1955 durften keine Neuzüchtungen mehr frei verkauft werden, was dazu führte, dass früher oder später alle privaten Züchter ihre Arbeit einstellen mussten. Roland Lenz kommentiert diese Entwicklung so: «Der Staat mit seinen ‹Verbündeten› aus der Chemie und Traditionalistenwinzern erreichte somit sein Ziel, die Züchtungsarbeit abzuwürgen und fortan selbst zu übernehmen und zu kontrollieren. Das bedeutete Stillstand, ja Rückschritt auf der ganzen Linie. Die Verlierer daraus sind die Konsumenten, die Winzer und vor allem die Natur!»
Das Besondere an den PIWIs ist eben, dass sie ohne synthetische Pestizide und selbst ohne Kupfer und Schwefel auskommen. Durch Züchtung haben die Pflanzen dickere Zellwände, wodurch ein Eindringen von Pilzen wirksam verhindert werden kann. Das ist gut für die Natur, aber wie ist der Geschmack? «Blindverkostungen, die wir immer wieder mit Fachleuten und Konsumenten durchführen, zeigen klar, dass das geschmackliche Potenzial der neuen Sorten riesig ist», sagt Roland Lenz. «Sie werden meist besser bewertet! Konsumenten, die keine bestimmte Stilrichtung eines Weines abgespeichert haben und somit noch unbelastet und offen sind, entscheiden sich eher für diese neuen Geschmacksrichtungen». Die vielen Erfolge der Weine von Lenz bei Wettbewerben zeigen, dass das keine leeren Worte sind: Das Weingut Lenz wurde 2015 und 2018 zum Schweizer Bio–Weingut des Jahres gekürt. «Und mit 4 x Gold und 3 x Silber sind wir auch 2021 beim Schweizer Bioweinpreis eines der erfolgreichsten Weingüter der ‹BioSchweiz›. Ausserdem wurden wir als erstes Bioweingut überhaupt zum Weingut des Jahres bei dem Baur au Lac gekürt, einem traditionsreichen 5–Sterne–Hotel mit angegliedertem exklusiven Weinhandel. Dazu konnten wir die Hausweinlinie für Baur au Lac, die Cuvée 1844–Linie, auf zehn Weinpersönlichkeiten erweitern.»
In der Schweiz befasst man sich ab den 1980er Jahren wieder vermehrt mit pilzresistenten Neuzüchtungen. Vor allem Valentin Blattner aus Soyhières (Kanton Jura) brachte in den letzten Jahren einige sehr erfolgreiche Neuzüchtungen auf den Markt, wie Cabernet Jura oder Cabernet blanc. «Seit 2017 unterstützen wir Valentin bei seiner Arbeit», sagt Roland Lenz. «Einerseits haben wir die Mikrovinifikationen seiner neuesten Hoffnungsträger übernommen (um das Weinpotenzial auszutesten) und andererseits legten wir 2018 einen Muttergarten mit über 100 noch namenlosen Neuzüchtungen an.» Weinliebhaber dürfen gespannt sein auf die neuen Aromen dieser noch namenlosen Sorten.

Karin und Roland Lenz beim Arbeiten im Weinberg
UMSTELLUNG AUF BIO UND PIWIs
Warum die PIWIs nicht längst zum Megatrend im Weinbau geworden sind, kann Roland Lenz nicht nachvollziehen. Denn der Arbeitsaufwand ist mit diesen Sorten deutlich geringer als im konventionellen Weinbau und auch geringer als im konventionellen Bioweinbau, weil eine ganze Reihe von Pflanzenschutzmitteln nicht nötig sind und damit viele Arbeitsgänge wegfallen. Man spart auch die Kosten für viele Hilfsmittel und die Natur wird deutlich weniger belastet. Trotzdem können mit den neuen Sorten tolle Erträge zu guten Preisen erzielt werden. Und das macht sie wirtschaftlich interessant.
Den Transformationsprozess für die einzelnen Weinbaubetriebe hin zu den PIWIs kann sich Roland Lenz so vorstellen: «Betriebswirtschaftlich ist es sinnvoll, dass ein Weinbaubetrieb jährlich zwischen drei und sechs Prozent seiner Rebflächen durch Jungpflanzen ersetzt. Wenn dabei die neuen Sorten gepflanzt werden, dann ist es möglich die Investitionskosten langfristig zu erwirtschaften und die Konsumenten langsam an die neuen Weine heranzuführen.»
Winzern, die vorhaben auf Bio umzustellen, rät Roland Lenz, dass sie zuerst damit anfangen sollten, auf PIWIs umzustellen. Denn bei diesen Rebsorten kann man sofort auf synthetische Pestizide verzichten, ohne ein grosses Risiko einzugehen. Der Anteil an PIWIs kann dann immer grösser werden. Parallel dazu kann man schrittweise die Methoden des biologischen Weinbaus kennenlernen, um die nicht pilzresistenten Sorten zu schützen, falls man sie weiter im Bestand haben möchte.
VIELFALT IM WEINGARTEN
Das Weingut Lenz arbeitet nach den Richtlinien von Delinat und Demeter und war bisher auch Mitglied bei Bio Suisse, dem Dachverband für biologische Landwirtschaft in der Schweiz. Das änderte sich im Zusammenhang mit den beiden Agrarinitiativen, über die im Juni 2021 von den Schweizer Bürgerinnen und Bürgern abgestimmt wurde. «Nachdem aber siebzig Prozent der Delegierten von Bio Suisse sich gegen die Initiative für sauberes Trinkwasser ausgesprochen hatten, waren wir sehr enttäuscht und haben unsere Mitgliedschaft gekündigt», sagt Roland Lenz. Die Zertifizierung bei Delinat zählt zu den strengsten Biozertifizierungen Europas. Stolze einhundertsechzehn Richtlinien sind zu befolgen, um diese anspruchsvolle Zertifizierung zu erhalten. Die Richtlinien von Delinat zielen konsequent darauf ab, dass sich Weinbaubetriebe zu komplexen Ökosystemen mit grosser Artenvielfalt entwickeln können. Und zwar durch:
1. Ökologische Ausgleichsflächen wie Magerwiesen, Heideland, Biotope, Hecken, Felsen, Wasserflächen, Trockensteinmauern usw.
2. Durch artenreiche Begrünungen um die Weinreben, bestehend aus Gräsern, Blumen und Kräutern
3. Durch biologische Hotspots wie Beerensträucher, Gemüsebeete, Holz- und Steinhaufen.
«Die vielleicht strengste Richtlinie von Delinat gibt vor, dass man ein halbes Jahr lang nicht mit Maschinen durch den Weinberg fahren soll. Ich kann mehr und mehr verstehen, dass es sinnvoll und gut ist, wenn wir die Natur, die Pflanzen und den Boden mal eine Weile in Ruhe lassen», meint Roland Lenz.
Karin und Roland Lenz sind in der Entwicklung ihrer Weingärten schon weit gekommen. Man könnte meinen, sie hätten schon alles erreicht. Was hat sie dazu bewogen, nun auch noch bei Demeter zertifiziert zu werden? «Ich hatte Martin Ott kennengelernt, der ja die biodynamische Ausbildung in der Schweiz aufgebaut und geleitet hat, und ich hatte das Gefühl, dass ich von ihm viel lernen kann. Ich wollte meine Beziehung zur Natur vertiefen und wusste, dass er bald in den Ruhestand geht, und so habe ich mich schnell noch für den Grundkurs angemeldet», erzählt Karin Lenz. «Was in früheren Zeiten vielleicht noch normal war, dass die Menschen eine tiefe Beziehung zur Natur hatten, das müssen wir uns heute mühsam wieder erarbeiten.»
Roland Lenz: «Wir haben einfach auch gemerkt, dass in diesem Ansatz von Demeter etwas liegt, was den Pflanzen, dem Boden und auch den Tieren einfach gut tut und uns auch. Für mich war auch der DOK–Versuch ein Grund. Das ist ja ein mit wissenschaftlichen Methoden durchgeführter Langzeitversuch, der über dreissig Jahre konventionelle, biologische und biodynamische Methoden miteinander verglichen hat. Dabei hat sich gezeigt, dass durch biodynamische Methoden bei der Humusbildung und den Treibhausgasen die besten Resultate erzielt werden können.»
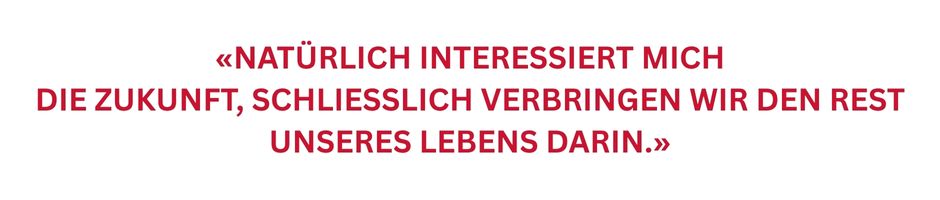
DAS WEINGUT UND DIE ENERGIE
Karin und Roland denken und handeln ganzheitlich, das ist nicht zu übersehen und sie arbeiten mit Begeisterung daran, auf allen Ebenen eine sehr hohe Qualität zu erreichen. Dabei wurde auch das Energiethema nicht ausgespart. Unterm Strich wird auf dem Weingut Lenz mehr Energie erzeugt als verbraucht. Dadurch wurde es zum ersten energieautarken Weingut der Schweiz und weltweit.
«Trotz der gut gedämmten Gebäudehülle des Neubaus wird die meiste Energie für die Beheizung der Gebäude und das Warmwasser gebraucht. Der Energiebedarf hierfür beträgt 61.000 kWh pro Jahr. Siebzig Prozent davon liefert die Erdsonde in Form von geothermischer Wärme. Das Kühlhaus ist hochisoliert und fünftausend kWh können aus der nutzbaren Abwärme der Kälteerzeugung zurückgewonnen werden. Zum Betrieb der Wärmepumpe sind noch 13.000 kWh elektrische Energie nötig.
Alle elektrische Energie wird auf dem Weingut Lenz durch die Photovoltaikanlagen erzeugt. Insgesamt sind das stolze 140.000 kWh. Damit wird auf dem Weingut Lenz mehr Energie erzeugt als verbraucht. Die Hälfte davon kann ins Netz eingespeist werden, weil sie nicht gebraucht wird, und das wird vergütet. Dadurch ist es möglich, über einen längeren Zeitraum die Reinvestitionskosten zu erwirtschaften für den Zeitpunkt, wo die alten Anlagen ausgetauscht werden müssen.
UND DIE ZUKUNFT VOM WEINGUT LENZ?
Für Karin und Roland wird die Nachfolge langsam ein Thema, denn sie haben die fünfzig bereits überschritten. «Unsere Tochter würde das Weingut gern weiterführen, aber sicher nicht allein», meint Karin. «Wir wollen das langsam angehen, denn es ist ja nicht nur eine Frage der Qualifikation, persönlich muss es ja auch stimmen», ergänzt Roland. Ansonsten wollen die beiden den Betrieb auf allen Ebenen weiter optimieren und da gibt es aus ihrer Sicht noch einiges zu tun. Und sie begleiten bereits mehrere Weingüter bei der Umstellung auf Bio. Sie arbeiten daran, dass sie dafür in Zukunft noch mehr Zeit und Raum zur Verfügung haben.
Wir wünschen der Familie Lenz weiterhin gutes Gelingen und freuen uns, dass sie ein Partnerhof des Bodenfruchtbarkeitsfonds sind.
Wir freuen uns, wenn Sie diesen Beitrag mit Ihrem Netzwerk teilen!

Hofportrait Weingut Lenz
Text Christopher Schümann
Fotos Lenz
Auf das Weingut Lenz sind wir vor einigen Jahren aufmerksam geworden, als wir mit der Herausgabe unseres Buches «Das Gift und wir» beschäftigt waren. Wir suchten für den dritten Teil nach Best-Practice-Beispielen, das heisst nach Betrieben, die zeigen, dass es auch ohne synthetische Pestizide geht und vor allem wie. Inzwischen ist das Weingut Lenz Partnerbetrieb im Bodenfruchtbarkeitsfonds geworden, worüber wir uns sehr freuen. Das Weingut von Karin und Roland Lenz liegt in Iselisberg bei Frauenfeld. Es ist das grösste biologisch–dynamische Weingut der Deutschschweiz. (Dieser Artikel ist erstmals im MAGAZIN 2/22 vom Juni 2022 erschienen.)
Auf zweiundzwanzig Hektar wachsen dort Reben an günstigen Südlagen mit sandig–lehmigen Böden. Die Parzellen sind mit weit über dreissig verschiedenen Rebsorten bestockt, fast alles pilzresistente Sorten. Dazu kommen viereinhalb Hektar Biodiversitätsflächen, die zwischen den Parzellen verteilt sind. Roland ist auf einem Weingut aufgewachsen, konnte also schon viel in seiner Kindheit und Jugend lernen, während Karin erst durch Roland dem Weinbau näherkam. Beiden ist wichtig, dass sich auf ihren Flächen langfristig stabile, klimaresistente, fruchtbare und artenreiche Weingärten entwickeln können. Und natürlich ist ihnen das Endergebnis wichtig: hervorragender Wein.
Das Jahr 2021 war für das Weingut Lenz, wie für viele andere Weingüter, wetterbedingt katastrophal. Für Roland Lenz ein klares Zeichen dafür, dass «die schnellste Klimaveränderung, die unser Planet je erlebt hat», in vollem Gange ist. Nach einem schneereichen Winter wurde es schnell warm und trocken. Von Januar bis Mai fiel wenig Niederschlag in Iselisberg. Die zweite Hälfte vom März war viel zu warm und der Frühjahrsfrost Mitte April liess nicht auf sich warten: Frühsorten wie Muscaris, Zweigelt oder auch Pinot Noir wurden in erhöhten Lagen stark geschädigt. Der viel zu kühle Mai verhinderte dann eine normale Vegetationsentwicklung. Erst als Anfang Juni die Temperaturen Fahrt aufnahmen, erholten sich wärmeliebende Kulturpflanzen wie die Weinrebe. Und mit der Wärme kam der Regen … «Nach vier Monaten mit spärlichem Niederschlag fiel über sechs Wochen lang starker Niederschlag, bei oft tropischen Verhältnissen. Herrliches Schnecken- und Pilzwetter! Zudem wurden die fast täglichen Gewitterregen von heftigen Sturmböen und vernichtendem Hagelschlag begleitet, was zu massiven Schäden führte.» Aufgrund dieser Erfahrungen haben Karin und Roland Lenz die Entscheidung getroffen, ab Jahrgang 2021 nur noch Weine aus PIWIs (pilzwiderstandsfähige Sorten) anzubieten, das heisst: der Anteil an PIWIs wird kurzfristig von 80% auf 100% erhöht – ein radikaler und konsequenter Schritt. «Damit werden wir das erste grössere Weingut in Europa, ja wahrscheinlich weltweit sein, das nur noch Weine aus PIWI–Traubensorten anbietet! Welche Gründe liegen dahinter? Und: was sind eigentlich PIWIs?

Karin und Roland Lenz
DIE NEUEN PILZRESISTENTEN SORTEN
Um das Potenzial dieser neuen Züchtungen für den Weinbau der Zukunft richtig einschätzen zu können, lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit: Anfang des 19. Jahrhunderts wurden erstmals amerikanische Rebsorten nach Frankreich importiert. Sie brachten den falschen und echten Mehltau sowie die Reblaus mit nach Europa und die Pilzkrankheiten und Schädlinge hatten aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen Gelegenheit, sich schnell auszubreiten. Die europäischen Sorten waren nicht resistent dagegen, was teilweise zu verheerenden Ertragsausfällen führte. Aber die Menschen liessen sich etwas einfallen. Es entstanden schnell Rebschulen, in denen resistente amerikanische Sorten mit europäischen gekreuzt wurden.
Anfangs weckten die neuen Sorten noch keine Begeisterung, sie wurden aber mit der Zeit immer besser und auch immer erfolgreicher. Der Sortenkatalog des privaten Rebzüchters Seibel führte zum Beispiel 1085 robuste Rebsorten! Ausserdem existierten zwischen den Jahren 1877 und 1968 diverse unabhängige Zeitschriften, die sich mit der Neuzüchtung resistenter Sorten befassten. Dies zeigt, wie aktuell das Thema schon einmal war, auch wenn das heute kaum noch jemand weiss. Aufgrund der beeindruckenden Züchtungsleistungen und der unabhängigen Berichterstattung darüber wurden in Frankreich im Jahr 1958 auf 402 000 Hektar PIWIs angebaut, was 30% der gesamten französischen Rebfläche entsprach. Von einer notdürftig am Leben gehaltenen Randerscheinung kann also keine Rede sein, wenn man auf diese Zeit zurückblickt. An renommierten Weinverkostungen wurden Weine aus den pilzresistenten Reben plötzlich besser bewertet als aus den traditionellen Traubensorten. Das gefiel den Burgunder- und Bordeauxwinzern nicht. Und ab 1955 begann der französische Staat damit, dieser Entwicklung entgegenzuwirken und die Freiheit der Winzer durch Dekrete und Klassifizierungen gezielt einzuschränken. Plötzlich waren durch die Klassifizierungen nur noch 20 PIWIs zugelassen und ab 1955 durften keine Neuzüchtungen mehr frei verkauft werden, was dazu führte, dass früher oder später alle privaten Züchter ihre Arbeit einstellen mussten. Roland Lenz kommentiert diese Entwicklung so: «Der Staat mit seinen ‹Verbündeten› aus der Chemie und Traditionalistenwinzern erreichte somit sein Ziel, die Züchtungsarbeit abzuwürgen und fortan selbst zu übernehmen und zu kontrollieren. Das bedeutete Stillstand, ja Rückschritt auf der ganzen Linie. Die Verlierer daraus sind die Konsumenten, die Winzer und vor allem die Natur!»
Das Besondere an den PIWIs ist eben, dass sie ohne synthetische Pestizide und selbst ohne Kupfer und Schwefel auskommen. Durch Züchtung haben die Pflanzen dickere Zellwände, wodurch ein Eindringen von Pilzen wirksam verhindert werden kann. Das ist gut für die Natur, aber wie ist der Geschmack? «Blindverkostungen, die wir immer wieder mit Fachleuten und Konsumenten durchführen, zeigen klar, dass das geschmackliche Potenzial der neuen Sorten riesig ist», sagt Roland Lenz. «Sie werden meist besser bewertet! Konsumenten, die keine bestimmte Stilrichtung eines Weines abgespeichert haben und somit noch unbelastet und offen sind, entscheiden sich eher für diese neuen Geschmacksrichtungen». Die vielen Erfolge der Weine von Lenz bei Wettbewerben zeigen, dass das keine leeren Worte sind: Das Weingut Lenz wurde 2015 und 2018 zum Schweizer Bio–Weingut des Jahres gekürt. «Und mit 4 x Gold und 3 x Silber sind wir auch 2021 beim Schweizer Bioweinpreis eines der erfolgreichsten Weingüter der ‹BioSchweiz›. Ausserdem wurden wir als erstes Bioweingut überhaupt zum Weingut des Jahres bei dem Baur au Lac gekürt, einem traditionsreichen 5–Sterne–Hotel mit angegliedertem exklusiven Weinhandel. Dazu konnten wir die Hausweinlinie für Baur au Lac, die Cuvée 1844–Linie, auf zehn Weinpersönlichkeiten erweitern.»
In der Schweiz befasst man sich ab den 1980er Jahren wieder vermehrt mit pilzresistenten Neuzüchtungen. Vor allem Valentin Blattner aus Soyhières (Kanton Jura) brachte in den letzten Jahren einige sehr erfolgreiche Neuzüchtungen auf den Markt, wie Cabernet Jura oder Cabernet blanc. «Seit 2017 unterstützen wir Valentin bei seiner Arbeit», sagt Roland Lenz. «Einerseits haben wir die Mikrovinifikationen seiner neuesten Hoffnungsträger übernommen (um das Weinpotenzial auszutesten) und andererseits legten wir 2018 einen Muttergarten mit über 100 noch namenlosen Neuzüchtungen an.» Weinliebhaber dürfen gespannt sein auf die neuen Aromen dieser noch namenlosen Sorten.

Karin und Roland Lenz beim Arbeiten im Weinberg
UMSTELLUNG AUF BIO UND PIWIs
Warum die PIWIs nicht längst zum Megatrend im Weinbau geworden sind, kann Roland Lenz nicht nachvollziehen. Denn der Arbeitsaufwand ist mit diesen Sorten deutlich geringer als im konventionellen Weinbau und auch geringer als im konventionellen Bioweinbau, weil eine ganze Reihe von Pflanzenschutzmitteln nicht nötig sind und damit viele Arbeitsgänge wegfallen. Man spart auch die Kosten für viele Hilfsmittel und die Natur wird deutlich weniger belastet. Trotzdem können mit den neuen Sorten tolle Erträge zu guten Preisen erzielt werden. Und das macht sie wirtschaftlich interessant.
Den Transformationsprozess für die einzelnen Weinbaubetriebe hin zu den PIWIs kann sich Roland Lenz so vorstellen: «Betriebswirtschaftlich ist es sinnvoll, dass ein Weinbaubetrieb jährlich zwischen drei und sechs Prozent seiner Rebflächen durch Jungpflanzen ersetzt. Wenn dabei die neuen Sorten gepflanzt werden, dann ist es möglich die Investitionskosten langfristig zu erwirtschaften und die Konsumenten langsam an die neuen Weine heranzuführen.»
Winzern, die vorhaben auf Bio umzustellen, rät Roland Lenz, dass sie zuerst damit anfangen sollten, auf PIWIs umzustellen. Denn bei diesen Rebsorten kann man sofort auf synthetische Pestizide verzichten, ohne ein grosses Risiko einzugehen. Der Anteil an PIWIs kann dann immer grösser werden. Parallel dazu kann man schrittweise die Methoden des biologischen Weinbaus kennenlernen, um die nicht pilzresistenten Sorten zu schützen, falls man sie weiter im Bestand haben möchte.
VIELFALT IM WEINGARTEN
Das Weingut Lenz arbeitet nach den Richtlinien von Delinat und Demeter und war bisher auch Mitglied bei Bio Suisse, dem Dachverband für biologische Landwirtschaft in der Schweiz. Das änderte sich im Zusammenhang mit den beiden Agrarinitiativen, über die im Juni 2021 von den Schweizer Bürgerinnen und Bürgern abgestimmt wurde. «Nachdem aber siebzig Prozent der Delegierten von Bio Suisse sich gegen die Initiative für sauberes Trinkwasser ausgesprochen hatten, waren wir sehr enttäuscht und haben unsere Mitgliedschaft gekündigt», sagt Roland Lenz. Die Zertifizierung bei Delinat zählt zu den strengsten Biozertifizierungen Europas. Stolze einhundertsechzehn Richtlinien sind zu befolgen, um diese anspruchsvolle Zertifizierung zu erhalten. Die Richtlinien von Delinat zielen konsequent darauf ab, dass sich Weinbaubetriebe zu komplexen Ökosystemen mit grosser Artenvielfalt entwickeln können. Und zwar durch:
1. Ökologische Ausgleichsflächen wie Magerwiesen, Heideland, Biotope, Hecken, Felsen, Wasserflächen, Trockensteinmauern usw.
2. Durch artenreiche Begrünungen um die Weinreben, bestehend aus Gräsern, Blumen und Kräutern
3. Durch biologische Hotspots wie Beerensträucher, Gemüsebeete, Holz- und Steinhaufen.
«Die vielleicht strengste Richtlinie von Delinat gibt vor, dass man ein halbes Jahr lang nicht mit Maschinen durch den Weinberg fahren soll. Ich kann mehr und mehr verstehen, dass es sinnvoll und gut ist, wenn wir die Natur, die Pflanzen und den Boden mal eine Weile in Ruhe lassen», meint Roland Lenz.
Karin und Roland Lenz sind in der Entwicklung ihrer Weingärten schon weit gekommen. Man könnte meinen, sie hätten schon alles erreicht. Was hat sie dazu bewogen, nun auch noch bei Demeter zertifiziert zu werden? «Ich hatte Martin Ott kennengelernt, der ja die biodynamische Ausbildung in der Schweiz aufgebaut und geleitet hat, und ich hatte das Gefühl, dass ich von ihm viel lernen kann. Ich wollte meine Beziehung zur Natur vertiefen und wusste, dass er bald in den Ruhestand geht, und so habe ich mich schnell noch für den Grundkurs angemeldet», erzählt Karin Lenz. «Was in früheren Zeiten vielleicht noch normal war, dass die Menschen eine tiefe Beziehung zur Natur hatten, das müssen wir uns heute mühsam wieder erarbeiten.»
Roland Lenz: «Wir haben einfach auch gemerkt, dass in diesem Ansatz von Demeter etwas liegt, was den Pflanzen, dem Boden und auch den Tieren einfach gut tut und uns auch. Für mich war auch der DOK–Versuch ein Grund. Das ist ja ein mit wissenschaftlichen Methoden durchgeführter Langzeitversuch, der über dreissig Jahre konventionelle, biologische und biodynamische Methoden miteinander verglichen hat. Dabei hat sich gezeigt, dass durch biodynamische Methoden bei der Humusbildung und den Treibhausgasen die besten Resultate erzielt werden können.»
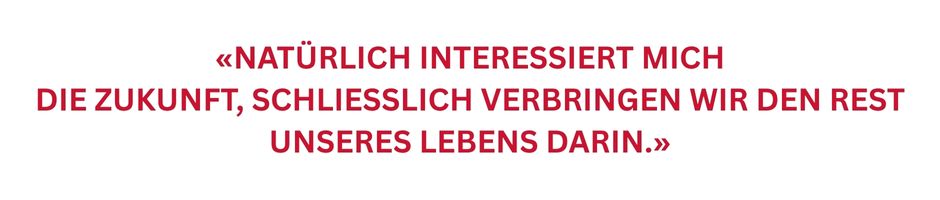
DAS WEINGUT UND DIE ENERGIE
Karin und Roland denken und handeln ganzheitlich, das ist nicht zu übersehen und sie arbeiten mit Begeisterung daran, auf allen Ebenen eine sehr hohe Qualität zu erreichen. Dabei wurde auch das Energiethema nicht ausgespart. Unterm Strich wird auf dem Weingut Lenz mehr Energie erzeugt als verbraucht. Dadurch wurde es zum ersten energieautarken Weingut der Schweiz und weltweit.
«Trotz der gut gedämmten Gebäudehülle des Neubaus wird die meiste Energie für die Beheizung der Gebäude und das Warmwasser gebraucht. Der Energiebedarf hierfür beträgt 61.000 kWh pro Jahr. Siebzig Prozent davon liefert die Erdsonde in Form von geothermischer Wärme. Das Kühlhaus ist hochisoliert und fünftausend kWh können aus der nutzbaren Abwärme der Kälteerzeugung zurückgewonnen werden. Zum Betrieb der Wärmepumpe sind noch 13.000 kWh elektrische Energie nötig.
Alle elektrische Energie wird auf dem Weingut Lenz durch die Photovoltaikanlagen erzeugt. Insgesamt sind das stolze 140.000 kWh. Damit wird auf dem Weingut Lenz mehr Energie erzeugt als verbraucht. Die Hälfte davon kann ins Netz eingespeist werden, weil sie nicht gebraucht wird, und das wird vergütet. Dadurch ist es möglich, über einen längeren Zeitraum die Reinvestitionskosten zu erwirtschaften für den Zeitpunkt, wo die alten Anlagen ausgetauscht werden müssen.
UND DIE ZUKUNFT VOM WEINGUT LENZ?
Für Karin und Roland wird die Nachfolge langsam ein Thema, denn sie haben die fünfzig bereits überschritten. «Unsere Tochter würde das Weingut gern weiterführen, aber sicher nicht allein», meint Karin. «Wir wollen das langsam angehen, denn es ist ja nicht nur eine Frage der Qualifikation, persönlich muss es ja auch stimmen», ergänzt Roland. Ansonsten wollen die beiden den Betrieb auf allen Ebenen weiter optimieren und da gibt es aus ihrer Sicht noch einiges zu tun. Und sie begleiten bereits mehrere Weingüter bei der Umstellung auf Bio. Sie arbeiten daran, dass sie dafür in Zukunft noch mehr Zeit und Raum zur Verfügung haben.
Wir wünschen der Familie Lenz weiterhin gutes Gelingen und freuen uns, dass sie ein Partnerhof des Bodenfruchtbarkeitsfonds sind.